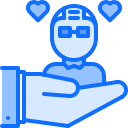Warum Sturzerkennung jetzt zählt
Wir werden älter und bleiben länger aktiv. Das ist wunderbar, bringt aber mehr Risikosituationen im Alltag mit sich. Ein zuverlässiges Sturzerkennungssystem schafft Sicherheit ohne Dauerbevormundung und stärkt das Gefühl, selbstbestimmt zu leben.
Warum Sturzerkennung jetzt zählt
Nicht nur Knochen brechen, auch Selbstvertrauen. Nach einem Sturz meiden viele das Spazierengehen oder die Treppe. Frühzeitige Erkennung und schnelle Hilfe verkürzen die Erholungszeit und beugen der Angst vor, erneut zu stürzen.